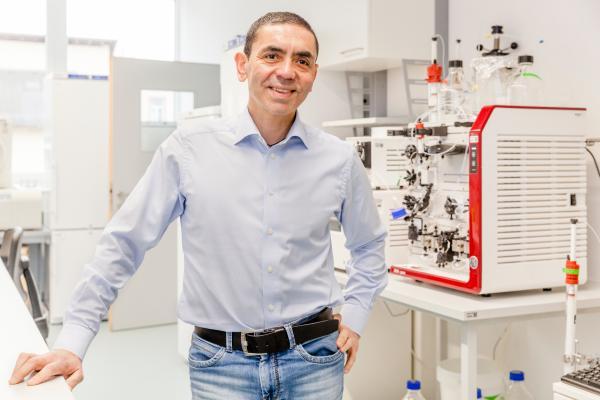Von Dana Burduja und Anna Lynch
Machen wir uns nichts vor: Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Entscheidungstragende neigen jedoch dazu, das auszublenden. Denn die Vorbereitungen sind teuer und zahlen sich vielleicht lange Zeit nicht aus. Deshalb muss die Politik jetzt Vorsorge treffen, solange die Erinnerung an Corona noch frisch ist und das Wunschvergessen nicht eingesetzt hat.
Was nicht heißt, dass Corona schon vorbei ist. Ein Ende der Pandemie ist zwar absehbar, doch die Krankheit wird bei uns bleiben und möglicherweise endemisch werden. Dabei hat sie bereits tiefe Spuren in unserem Leben, unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft hinterlassen. Die nächste Pandemie wird neu und anders sein. Wenn sie weniger epochale und katastrophale Folgen haben soll, müssen sich Wissenschaft und Politik Hand in Hand darauf vorbereiten. Wir können nicht vorhersagen, welche Krankheit zuschlagen wird. Wir können aber die Erfahrungen aus Corona für unsere Zukunftsplanung nutzen – und das schon jetzt.
Ein Teil der Vorsorge ist allgemeiner Natur und bezieht sich nicht speziell auf die Krankheit, die – wie auch immer – das nächste Mal die Welt heimsuchen wird. Eine wichtige Erkenntnis aus Corona ist, dass die Beobachtung von Infektionskrankheiten und ihre Erforschung vernachlässigt wurden. Die Konzentration auf nicht minder bedrohliche Erkrankungen wie Herzleiden und Krebs war attraktiver. Doch die Pandemie führt uns vor Augen, wie überlebenswichtig die Erforschung von Infektionskrankheiten ist, von ihrer Entwicklung über Diagnosetools und Behandlungen bis hin zu Impfstoffen. Das A und O aber ist, dass sich die Politik der potenziellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen einer Pandemie bewusst ist.
Die Politik muss die Verantwortung für die Risiken einer mangelnden Pandemievorsorge übernehmen. In der Coronapandemie war die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft nicht optimal. Sie muss aufgewertet und neu strukturiert werden. Das schließt einen organisatorischen Koloss wie die Weltgesundheitsorganisation ein, deren Prozesse und Funktionen sich als überholt erwiesen oder der Aufgabe nicht gewachsen waren.